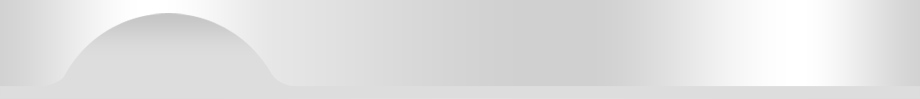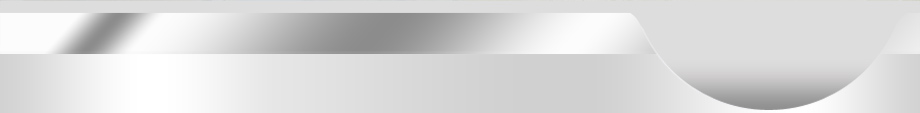

 |
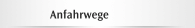 |
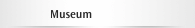 |
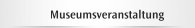 |
 |
 |
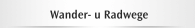 |
 |
 |
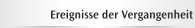 |

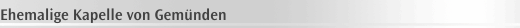
Detail-Reproduktion: Bruno Rühl im Jahre 2000; Original: Gemälde "Gemündener Backes" vom Kunstmaler Heinz Müller (Gemünden im Taunus).
................................................................................................................................
Eine Kapelle in Dreiachtelchorschluss-Bauweise wurde 1580 als zwischen dem Zusammenfluss von Laubach und Sattelbach liegend erwähnt. Nach geringer kirchlicher Nutzung baufällig und zudem hochwassergeschädigt, wurde sie 1828 zum Backhaus umgebaut. In Gemünden stieg die Einwohnerzahl stetig, so wurden Räume für die Nutzung als Bürgermeisterei gesucht. Dafür wurde also das älteste Gebäude in Gemünden, die Kapelle, im Jahre 1948 aufgestockt, die neuentstandenen Räumlichkeiten wurden bis 1972 als Rathaus genutzt und später (seit 1977) vom Landfrauenverein Gemünden zum Heimatmuseum umgestaltet. 1996 wurden biblischen Wandmalereien aus dem 15. Jahrhundert im alten Backraum entdeckt.
Entdeckung von Wandmalereien.
Viele Umbau- und Renovierungsarbeiten wurden schon an diesem historischen Gebäude getätigt. Aber erst im Jahre 1996 entdeckten Gemündener Bürger, Richard Löw, Rudolf Schmidko und Reinhold Zwengel, Wandmalereien mit Darstellungen aus dem Alten und Neuen Testament: Adam und Eva unter dem Baum der Erkenntnis. Die Verkündigung des Engels an Maria. Maria und Elisabeth. Der Auferstandene mit dem ungläubigen Thomas. Fragmentarisch vorliegende Christusfigur. Noch nicht freigelegt. Die in Naturfarben gemalten biblischen Szenen sind noch gut erhalten. Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen erklärte anhand der Form und Farbe der Gemälde das diese aus dem 15. Jahrhundert stammen. Das bestätigt die Vermutung dass das Gebäude schon lange vor seiner Ersterwähnung erbaut worden sein muss.

1. Und die Schlange war listiger denn alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe: Ihr sollt nicht essen von allerlei Bäumen im Garten. 2. Da sprach das Weib zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten; 3. aber von den Früchten des Baums mitten im Garten hat Gott gesagt: Esset nicht davon, rühret’s auch nicht an, daß ihr nicht sterbet. 4. Da sprach die Schlange zum Weib: Ihr werdet mitnichten des Todes sterben; 5. sonder Gott weiß, daß, welches Tags ihr davon esset, so werden eure Augen aufgetan, und werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. 6. Und das Weib schaute an, das von dem Baum gut zu essen wäre und lieblich anzusehen, daß es ein lustiger Baum wäre, weil er klug machte, und nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann auch davon, und er aß. 7. Da wurden ihr beiden Augen aufgetan, und wurden gewahr, daß sie nacket waren, und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen.


(Ev. am Tag Mariä Heimsuchung) 39. Maria aber stund auf in den Tagen und ging auf das Gebirge eilends zu der Stadt Judas 40. und kam in das Haus Zacharias und grüßte Elisabeth. 41. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth ward des heiligen Geistes voll 42. und rief laut und sprach: Gebenedeiet bist du unter den Weibern, und Gebeneteiet ist die Frucht deines Leibes! 43. Und woher kommt mir das, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 44. Siehe, da ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte mit Freude das Kind in meinem Leibe. 45. Und o selig bist du, die du geglaubt hast! denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. 46. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn, 47. und mein Geist freuet sich Gottes, meines Heilandes; 48. denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder; 49. denn er hat Große Dinge an mir getan, der da mächtig ist, und des Name heilig ist.

Text zu den Wandmalereien aus: Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung D. Martin Luthers. Durchgesehen im Auftrag der Deutschen Evangelischen Kirchenkonferenz. Stuttgart 1911 Privilegierte Württembergische Bibelanstalt.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Letzte Aktualisierung von Bruno Rühl im Juni 2023
Im Moment bereiten wir die Inhalte für diesen Bereich vor. Um Sie auf gewohntem Niveau informieren zu können, werden wir noch ein wenig Zeit benötigen. Bitte schauen Sie daher bei einem späteren Besuch noch einmal auf dieser Seite vorbei. Vielen Dank für Ihr Interesse!